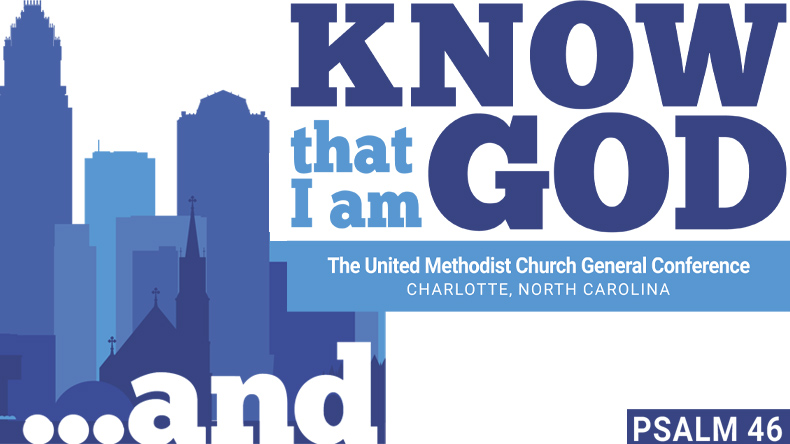In der Küche fing alles an
In allen drei deutschen Jährlichen Konferenzen der Evangelisch-methodistischen Kirche (EmK) ist derzeit ein Thema aktuell: die verstärkt nötige Mitwirkung von Laien in der Kirche. Anlass dafür sind der Zusammenschluss von Gemeinden zu größeren Einheiten oder die zunehmende Zahl von Gemeinden, die mindestens eine gewisse Zeit ohne Pastor sind. Die Distriktsversammlung der Laien der beiden Distrikte Dresden und Zwickau nahm sich am vergangenen Wochenende, 17. bis 19. März, dieses Themas an. Unter dem Motto »Zurück in die Zukunft – Laienarbeit vom frühen Methodismus bis morgen« trafen sich die Laien der Ostdeutschen Jährlichen Konferenz dazu im Begegnungs- und Bildungszentrum Schwarzenshof im Thüringer Wald. Den thematischen Mittelpunkt bildete ein Referat des Historikers und evangelisch-methodistischen Laienpredigers Michael Wetzel.
Hausandacht ohne Pfarrer
In der Küche seiner Mutter »wurde geistlicher Segen durch Laien das erste Mal für John Wesley greifbar«. Dort, im Pfarrhaus von Epworth, dreihundert Kilometer nördlich von London, habe die Pfarrfrau Susanna Wesley in Abwesenheit ihres Mannes Andachten gehalten. »Irgendwann«, so erzählt der promovierte Historiker Michael Wetzel weiter, »war die Küche zu klein, da die Zuhörerschar von Mutter Wesley bis auf etwa zweihundert Personen anwuchs«. John, ein damals noch ganz junger Sohn dieser Pfarrfrau, konnte nicht ahnen, dass in dieser Pfarrhausküche die Grundlagen kirchlicher Laienmitarbeit gelegt wurde.
Pragmatismus des Kolonialpfarrers
Trotz dieser kindlichen Urerfahrung sei für den späteren Impulsgeber der methodistischen Erweckungsbewegung der Weg zur selbstverständlichen Anerkennung von Laien als qualifizierte Mitarbeiter in der Kirche noch weit gewesen. Als studierter anglikanischer Geistlicher und Pfarrer der Kirche von England gab es für Wesley zunächst nur pragmatische Gründe, die Laien in kirchliche Aufgaben mit einzubeziehen.
Im Dienst als Kolonialpfarrer im amerikanischen Georgia sahen Wesley und andere Kirchenverantwortliche im Einsatz von Laien die Möglichkeit, den chronischen Pfarrermangel abzumildern. Sogenannte »Laienvorleser« füllten die Lücken leerer Pfarrstellen. Unter den Siedlern seien diese Laien »bald beliebter als die ordinierten Pfarrer« gewesen. Wetzel, selbst Laienprediger und darüber hinaus sogar »mit Dienstzuweisung« quasi »als Pastor« für Gemeinden zuständig, zitiert diese historische Begebenheit süffisant unter den schmunzelnden Reaktionen der versammelten Laien. Darüber hinaus, so Wetzel weiter, habe das ungewohnte Klima in den englischen Kolonien zu unzähligen Fieberpatienten geführt. John Wesley brauchte somit für die vielen Krankenbesuche Unterstützung und organisierte dafür einen vornehmlich von Frauen getragenen Laienbesuchsdienst.
Prüfung am urchristlichen Ideal
Die nachhaltigsten Impulse und viele praktische Anregungen habe Wesley allerdings von der Gemeinschaft der Herrnhuter erhalten. Die »Vielzahl und Geordnetheit der Laienämter« beeindruckten Wesley immens, so Wetzel. Es habe »Almosenverwalter, Krankenwärter und Kinderkatecheten sowie Aufseher über die Siedlungsorganisation« gegeben. Das für John Wesley Entscheidendste sei »die gegenseitige und regelmäßige Seelsorge in Kleingruppen« gewesen. Daraus entwickelte er später die methodistischen Klassen. Auf Basis dieser Erfahrungen habe Wesley »ganz einfachen Menschen diese Aufgabe zugetraut, weil er in der Kleingruppenstruktur starke Bezüge zum Urchristentum entdeckte«. Der biblische Rückbezug sei für ihn immer maßgeblich gewesen, wenn er Neuerungen zuließ. Sie waren somit nicht nur pragmatisch, wie Wetzel erklärt: »Er prüfte diese an seinem Idealbild der urchristlichen Gemeinde.«
Übersetzungshelfer in die Lebenswelt einfacher Leute
Neben diesen Erfahrungen und biblischer Begründung gab es zwei weitere Entdeckungen, die Wesleys Öffnung für die Laienmitarbeit beförderten. »Der praktische und lebensnahe Sinn der Laien« machte sie »gewissermaßen zu den vorrangigen Übersetzungshelfern der Heilspredigt in die Lebenswelten der einfachen Leute hinein«. In dieser Entwicklung war die Ermöglichung des Predigtdienstes durch Laien die logische Fortsetzung. Zunächst war auch das als Notbehelf in bestimmten Situationen gedacht. Weil Wesley »nichts Unbiblisches darin erkennen konnte«, wurde daraus »eine dauerhafte Einrichtung, die viele Früchte brachte«.
Vertrauen und Wertschätzung
Dass sich die Einbeziehung von Laien in die kirchliche Mitarbeit als erfolgreich und nachhaltig erwies, lasse sich aber nicht nur mit Wesleys Pragmatismus und organisatorischem Geschick erklären. Auch der immer erfolgte biblische Rückbezug sei nicht die Erklärung so Wetzel. Vielmehr habe Wesley noch etwas Wichtigeres weitergegeben: »Vertrauen und Vorbild«. Wesley habe den Laien etwas zugetraut. Wetzel: »Vertrauen erzeugt Zutrauen, und so wurde die Mitverantwortlichkeit der Laien auch zu einem Mittel der Wertschätzung von gesellschaftlich übersehenen Menschen.« So habe die Mitwirkung von Laien nicht nur Lücken der kirchlichen Arbeit geschlossen, sondern das Leben von Menschen nachhaltig geändert, die wiederum in ihrer Umgebung die Lebenswelt anderer Menschen nachhaltig prägten.
Späte Beteiligung an der Leitung der Kirche
Die Selbstverständlichkeit zunehmender Mitwirkung von Laien in vielen Bereichen des kirchlichen Dienstes habe sich interessanterweise erst spät in der Beteiligung an der Leitung der Kirche niedergeschlagen, wie Wetzel darlegte. In Amerika habe 1824 eine Debatte begonnen, »ob und wenn ja, in welcher Form Laien einen Zugang zur Generalkonferenz erhalten sollten«. Es folgten fast fünfzig Jahre mit viel Streit und Kirchenspaltung bis 1872 erstmals bei der Generalkonferenz der Bischöflichen Methodistenkirche Laien beteiligt waren. Jede Jährliche Konferenz durfte zwei in sogenannten Laienwahlkonferenzen bestimmte Delegierte entsenden. Erst im Jahr 1900, also weitere fast dreißig Jahre später, tagte die Generalkonferenz der Bischöflichen Methodistenkirche »in paritätischer Besetzung, also je zur Hälfte Ordinierte und Laien«.
Wetzels Resümee: »Laien waren und sind die Kristallisationspunkte für die geistliche Arbeit vor Ort.« Mit Wesleys Pragmatismus und Wertschätzung wurde ein wesentliches Element für die Ausbreitung des Evangeliums erschlossen, das damit zum selbstverständlichen Teil kirchlicher Arbeit wurde. Folgerichtig sei daraus auch ein paritätischer Anteil an der Leitung der Kirche erwachsen, weil Laien »besondere Kompetenzen, vor allem ihre Verwurzelung im praktischen Leben und ihren Zugang zur Lebenswelt ihrer Mitmenschen, einbrachten«.
Wenn Gott lobt, befreit das vom Urteilszwang
In einer dem Referat vorausgehenden Bibelarbeit entfaltete Werner Philipp Überlegungen des Apostels Paulus aus dem ersten Korintherbrief (Kapitel 4, Verse 1-5). Der Superintendent des Zwickauer Distrikts komprimierte diese Überlegungen angesichts der heutigen Anforderungen an die kirchliche Arbeit vor Ort in entlastenden Aussagen.
Wichtig sei, so Philipp, zu erkennen, dass Kirche nicht wie ein Verein, Betrieb oder Hobby anzusehen sei. »Kirche ist Gottes Sache«, weshalb die Zukunft der Kirche »nicht in unserer Hand« liege. Deshalb gehe es letzten Endes »nicht um die Frage unseres Könnens und Erfolgs, sondern um unsere Treue«. Außerdem, so der Superintendent weiter, gehe es in der Kirche um »dienende Leiterschaft«. Verantwortliche in Kirche und Gemeinde seien »Diener und Hausverwalter und nicht Herren und Eigentümer«. Für die Zusammenarbeit sei das entlastend, denn, so Philipp: »Autoritäts- und Machtfragen haben einen vorgegebenen Rahmen: Nur einer ist Herr.«
Schlussendlich wies der Superintendent darauf hin, wie verletzende und endgültige Urteile im Umgang miteinander vermieden werden könnten. Gott allein sei es, der richte. In der Beurteilung kirchlichen Lebens und menschlichen Handelns sei das entlastend. Es befreie von letzten Urteilen, die übereinander oder über sich selbst gefällt würden. Interessant sei, so Philipp, dass Paulus diesen kurzen Briefabschnitt damit beschließe, dass »am Ende allen Gottes Lob zuteilwerde«. Wenn Gottes Urteil mit einem Lob ende, sei das für die Selbstbewertung und vor allem auch für die Bewertung anderer befreiend. Das könne manche erbitterte Diskussion und den Drang, alles bis ins Letzte geklärt haben zu müssen, entkrampfen. Auf dieser Basis gebe es mehr Möglichkeiten für Begegnung und Zusammenwirken als für Streit und Trennung.
Zuversicht trotz großer Herausforderungen
Die Themen der Distriktsversammlung waren am Puls der Fragen, die in Deutschland an vielen Stellen in der Evangelisch-methodistischen Kirche momentan bewegt werden. Die Kraft der Mitwirkung von Laien in der Kirche lasse sich aus dem Blick in die methodistische Geschichte für die heutige und künftige methodistische Gemeindearbeit vor Ort neu entfalten. Die Atmosphäre der Distriktsversammlung ließ trotz großer Herausforderungen Zuversicht erkennen.
Der Autor
Klaus Ulrich Ruof ist Referent für Öffentlichkeitsarbeit und Pressesprecher für die Evangelisch-methodistische Kirche in Deutschland mit Sitz in Frankfurt am Main. Kontakt: oeffentlichkeitsarbeit(at)emk.de.
Zur Information
Das Referat von Dr. Michael Wetzel unter dem Thema »Von Wesley bis zur Laienarbeit im Methodismus in Deutschland« soll bis Mitte des Jahres in der Reihe EmK-Forum erscheinen.